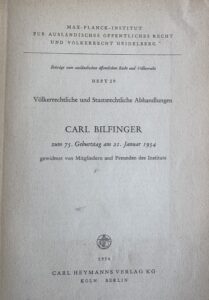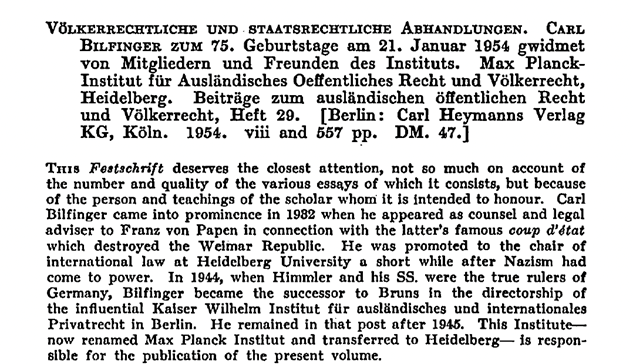Wie im kürzlich erschienenen Dokumentationsband ausgewählter Schriften und Korrespondenzen Carl Bilfingers dargestellt, verwundert im Rahmen der Nachkriegsgeschichte des Heidelberger Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (MPIL) vor allem dessen Berufung auf den Direktorenposten.[1] Nicht weniger erstaunlich als diese auch seinerzeit umstrittene Berufung ist jedoch, dass Bilfinger kurze Zeit später auch noch eine Festschrift gewidmet wurde, die seine politischen Aktivitäten während des sogenannten Dritten Reichs mit keinem Wort erwähnte. Vorliegender Beitrag zeichnet nach, wie dieser Umstand auf den vor den Nationalsozialisten nach England geflohenen Ernst Joseph Cohn wirkte. Insbesondere werden anhand von Cohns Rezension der Bilfinger-Festschrift dessen Sorgen über die geistige und politische Zukunft Deutschlands herausgearbeitet.
1954 feierte Carl Bilfinger, der als Direktor des MPIL gerade erst in den Ruhestand getreten war, seinen 75. Geburtstag. Zu diesem Anlass besorgte sein Nachfolger Hermann Mosler die Veröffentlichung einer umfangreichen Festschrift. „Völkerrechtliche und staatsrechtliche Abhandlungen“ erschien noch im selben Jahr im Carl Heymanns Verlag als Heft 29 der Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht.[2] Auf mehr als 500 Seiten äußerten sich siebzehn Wissenschaftler und zwei Wissenschaftlerinnen zu aktuellen Fragen wie der „Stellung der Nichtmitglieder der UN“ oder der „Rechtsform einer europäischen Staatengemeinschaft“. Bemerkenswerterweise war auch Erich Kaufman, der 1938, als Jude verfolgt, vor den Nationalsozialisten in die Niederlande geflohen war, mit einem Beitrag zu „für die Aburteilung von ‘Kriegsverbrechen’ eingesetzten Gerichtsbarkeiten“ vertreten, wohingegen der frühere KWI-Mitarbeiter und ebenfalls antisemitisch verfolgte spätere Verfassungsrichter Gerhard Leibholz bereits 1949 energisch bei dem KWG-Präsidenten Otto Hahn gegen Bilfingers Wiederberufung protestiert hatte.[3]
Wie bei Werken dieser Art nicht ungewöhnlich, erregte die Bilfinger-Festschrift zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung keine besondere Aufmerksamkeit. Zwei Jahre später jedoch, im Frühjahr 1956, erschien eine überaus kritische Rezension in der renommierten britischen Modern Law Review.[4] Verfasst worden war sie von Ernst Joseph Cohn, einem aus dem Dritten Reich vertriebenem deutsch-jüdischen Rechtsanwalt und Juristen.[5]

Ernst Cohn 1939[6]
Aufgrund seiner vielversprechenden Leistungen in Forschung und Lehre war Cohn 1932, zu diesem Zeitpunkt noch nicht dreißigjährig, auf einen zivilrechtlichen Lehrstuhl an der Universität Breslau berufen worden. Noch im gleichen Jahre wurde er Opfer einer von deutsch-nationalen Studenten orchestrierten Schmier- und Gewaltkampagne. Im Rahmen des sogenannten „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ wurde Cohn dann bereits im Frühjahr 1933 in den Zwangsruhestand versetzt. Über die Schweiz floh er nach England, wo er bald als barrister zugelassen wurde. Neben seiner Anwaltstätigkeit unterstützte Cohn die britische Regierung – gerade auch während des Zweiten Weltkriegs – mit seinem Fachwissen zum deutschen Recht. Sein Manual of German Law war auch nach dem Krieg noch jahrzehntelang Grundlage deutschrechtlicher sowie rechtsvergleichender Lehren an britischen Universitäten. Darüber hinaus kritisierte Cohn ganz offen die Entwicklung der Rechtswissenschaft in seiner alten Heimat. Nicht nur schien ihm die politische Einförmigkeit ostdeutscher Juristen problematisch; die fehlende Auseinandersetzung westdeutscher Juristen mit dem Nationalsozialismus und seinen Befürwortern, gerade auch in den eigenen Reihen, ließ ihn an der Zukunft zweifeln.
In seiner Modern Law Review Rezension stellte Cohn dementsprechend die Würdigkeit des mit der Festschrift Geehrten in Frage. In seinen Augen war Bilfinger kein bloßer Mitläufer gewesen. Obwohl Bilfinger selbst dies im Rahmen seines Entnazifizierungsverfahrens immer wieder bestritten hatte, handelte es sich bei ihm in Cohns Augen um einen Antidemokraten erster Güte. So zog Cohn eine direkte Verbindungslinie zwischen Bilfingers Beitrag zum Preußenschlag-Prozess, Hitlers Aufstieg und Deutschlands Niedergang: „Carl Bilfinger came into prominence in 1932 when he appeared as counsel and legal adviser to Franz von Papen in connection with the latter’s famous coup d’état which destroyed the Weimar Republic.“ Nach Hitlers Machtergreifung sei Bilfinger ein „active adherent to, and a blind supporter of, the Nazi system of blood and terror” gewesen.
Neben Bilfinger selbst galt Cohns Kritik aber insbesondere auch den für die Festschrift verantwortlichen Herausgebern Hermann Mosler und Georg Schreiber. Dabei betonte Cohn mehrfach, dass das – nicht zuletzt durch deutsche Steuergelder finanzierte – Heidelberger MPIL die Publikation unterstützt hatte. „Unfortunately, and contrary to general usage,“ so Cohn, hatten Mosler und Schreiber es nicht nur vernachlässigt, Bilfingers Biographie in ihrer Gänze zu würdigen, sie hatten auch strategisch davon abgesehen, der Festschrift eine vollständige Liste mit Bilfingers Werken beizufügen. Eine solche Liste hätte zum Beispiel Bilfingers Kurzaufsatz „Zum zehnten Jahrestag der Machtübernahme“ von 1943[7] enthalten müssen, in der der Jubilar die nationalsozialistische Revolution in den höchsten Tönen gelobt hatte. So wäre für jedermann ersichtlich gewesen, dass Bilfinger das sogenannte Dritte Reich bis zu dessen Ende öffentlich, ausdrücklich und enthusiastisch befürwortet hatte.
Am schwersten aber wog für Cohn das Lob, welches die Herausgeber dem „verehrte[n] Jubilar“ in ihrem Geleitwort ausgesprochen hatten. Bilfingers Name, so Mosler und Schreiber, sei „[s]eit einem Jahrzehnt… mit dem Institut untrennbar verbunden.“ Der Wiederaufbau desselben sei das „eigenste […] Werk“ des frisch emeritierten Institutsdirektors. Bilfingers größtes „Verdienst“ sei es jedoch gewesen, dass dieser „über den Zusammenbruch hinweg jene Atmosphäre des praktizierten Humanismus“ fortgesetzt habe, die sein Vorgänger Viktor Bruns einst geschaffen hatte. „One must seriously ask,” wetterte Cohn in der Modern Law Review, “what the meaning of these words can be if applied to one of the scientific propagandists of the legal theory which supported concentration camps and gas chambers. Was the genocide, committed by the German New Order for Europe, “practical humanism”?” Und weiter: „One may wish to forgive those who […] have […] actively assisted a régime of cruel terror, whose responsibility for World War II no sane person can doubt. But is it morally right—or is it even merely politically tactful—to honour and to praise the representatives of the Nazi legal theory as ‘practical humanists’?”
Bezeichnenderweise sah Cohn Bilfingers Festschrift nicht nur als schlechtes Vorzeichen für das Wirken Moslers und des in der frühen Bundesrepublik hochschulpolitisch höchst einflussreichen Prälaten Schreiber sowie für die Entwicklung des Heidelberger Instituts, sondern für Deutschlands geistige und moralische Entwicklung ein Jahrzehnt nach Ende des Zweiten Weltkriegs insgesamt. In einem auf die Rezension folgenden Briefwechsel mit Mosler führte Cohn seine Kritik weiter aus.[8] Die Tatsache, dass es sich bei Mosler und Schreiber um „alles andre als Gesinnungsgenossen von Carl Bilfinger“ handle, mache die Herausgabe der Festschrift „nur noch bedauerlicher und noch wichtiger.“ „Man kann es verstehen,“ so Cohn, „wenn die Gesinnungsgenossen solche Festtage begehen. Davon braucht man keine Notiz zu nehmen. Wenn aber andre dies tun, so ist es ein Zeichen, das nicht übersehen werden darf, – ein Zeichen dafür, wie weit das Vergessen und Vergeben gegangen ist, gerade auch bei denen, die keinen Anlass haben zu vergessen und die neben dem Vergeben auch der Vorsicht gedenken sollten.“ Von einer Bilfinger-Festschrift seien es „nur noch ein paar Schritte“ bis zu einer „Ehrung Carl Schmitts.“
Darüber hinaus drückte Cohn Mosler gegenüber seine Befürchtungen darüber aus, was die Veröffentlichung der Bilfinger-Festschrift für Deutschlands politische und geistige Zukunft bedeutete. Insbesondere glaubte er, Parallelen zwischen dem intellektuellen Milieu der 1920er und der 1950er Jahre zu sehen: „Die Weimarer Republik,“ erklärte Cohn, sei „zum Teil auch daran zugrunde gegangen, dass sie vor ihren Gegnern kapitulierte.“ „Wenn [das Institut] […] Herrn Bilfinger ehrte, so zeig[e] dies, dass die Gefahr einer gleichen Entwicklung in der Bundesrepublik besteh[e].“ So erblickte Cohn hinter der Veröffentlichung „jenen Hang zu weichlichem Kompromiss mit den Kräften eines unversöhnlichen Nationalismus und Militarismus, der die deutschen Liberalen, Demokraten, Sozialisten und Internationalisten aller Schattierungen immer wieder von neuem in Niederlage und Tod getrieben“ habe.
Die Tatsache, dass Mosler infolge seiner Korrespondenz mit Cohn den Austausch mit Kollegen suchte, zeigt, dass er von dessen Rezension tief getroffen war. Der Staatsrechtler Ulrich Scheuner jedoch beschwichtigte ihn. Cohns scharfe Worte, so Scheuner, seien durch dessen „begreifliche[] psychologische[] Hintergründe“ zu erklären. Die ständige Erinnerung an das Dritte Reich und seine Opfer gehöre nun einmal „zu den schweren Hypotheken,“ „zu den Lasten, welche wir in Deutschland auf lange zu tragen haben.“ Von Anfang an sei zu erwarten gewesen, dass sich „Kritik [an der Festschrift] erheben konnte.“ Allerdings hätten nicht nur Bilfingers „menschliche[] und persönliche[] Integrität“ sondern auch die „Kontinuität des Instituts“ es ihm, Scheuner, als „richtig“ erscheinen lassen, sich an dem Projekt mit einem Aufsatz zu beteiligen.
Cohns Rezension im Modern Law Review zog wohl keine weiteren Konsequenzen nach sich. Trotzdem sollte sie auch heute noch zu denken geben. Zum einen werfen Cohns Rezension sowie sein Briefwechsel mit Mosler ein interessantes Licht darauf, wie Bilfingers wissenschaftliche Rehabilitation nach Ende des Zweiten Weltkriegs international wahrgenommen und beurteilt wurde. Natürlich wurden die Aktivitäten eines sich weltoffen gebenden – und durch deutsche Steuergelder finanzierten – MPIL, das die Tradition des international hoch angesehenen Kaiser-Wilhelm-Instituts fortsetzte, auch außerhalb Deutschlands mit Aufmerksamkeit verfolgt. Fragen akademischer und juristischer Kontinuität waren nicht nur innen- sondern auch außenpolitische Angelegenheiten; Teil nicht nur deutscher, sondern globaler Geschichte. Vor dem Hintergrund von Cohns scharfer Kritik wäre es interessant zu fragen, wie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus anderen Teilen der Welt auf Bilfingers Berufung und seine Festschrift reagierten.
Darüber hinaus erweitert Cohns Rezension den Betrachtungsrahmen von der späten Nachkriegszeit zur Zeit der frühen beziehungsweise nicht mehr ganz so frühen Bundesrepublik. 1949, so zeigt Felix Lange in seinem Beitrag zum Dokumentationsband überzeugend auf, fehlte es wohl an personellen Alternativen zu dem im Spruchkammerverfahren „reingewaschenen“ Bilfinger.[9] Ob diese Begründung 1954 auch die Veröffentlichung einer Festschrift rechtfertige, beziehungsweise gebot, darf bezweifelt werden. Der Dokumentationsband bezeichnet Bilfinger als einen „zentrale[n] Akteur der Frühgeschichte des Instituts sowie des Umbruchs und Übergangs vom Nationalsozialismus in die Bundesrepublik.“[10] 1954 und 1956 kann man vielleicht noch von Umbruchs- oder Übergangszeit sprechen. Jedoch lagen in vielerlei Hinsicht Welten zwischen einem fünfjährigem und einem zehnjährigen Abstand zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Cohns Sorge über die geistige und politische Zukunft der Bundesrepublik ist vor diesem Hintergrund also mehr als verständlich. Die erste Festschrift für Carl Schmitt, die 1959 erschien,[11] war zum Zeitpunkt von Cohns Rezension wohl bereits in Arbeit.
***
[1] Philipp Glahé/Reinhard Mehring/Rolf Rie߆, Der Staats- und Völkerrechtler Carl Bilfinger (1879–1958) Dokumentation seiner politischen Biographie. Korrespondenz mit Carl Schmitt, Texte und Kontroversen, Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht Bd. 331, Baden-Baden: Nomos 2024.
[2] Hermann Mosler/Georg Schreiber (Hrsg.), Völkerrechtliche und Staatsrechtliche Abhandlungen: Carl Bilfinger zum 75. Geburtstag am 21. Januar 1954 gewidmet von Mitgliedern und Freunden des Instituts, Köln: Carl Heymanns Verlag 1954.
[3] Johannes Mikuteit, “Einfach eine sachlich politische Unmöglichkeit“. Die Protestation von Gerhard Leibholz gegen die Ernennung von Carl Bilfinger zum Gründungsdirektor des MPIL, MPIL100.de.
[4] Ernst J. Cohn, [Rezension] Völkerrechtliche und staatsrechtliche Abhandlungen. Carl Bilfinger zum 75. Geburtstag am 21. Januar 1954 gewidmet von Mitgliedern und Freunden des Instituts. Max-Planck-Institut für Ausländisches Oeffentliches Recht und Völkerrecht, Berlin 1958, The Modern Law Review 19 (1956), 231–233, zitiert nach: Glahé/Mehring/Rieß (Fn. 1), 343–345.
[5] Zu Cohn siehe: Werner Lorenz, Ernst J. Cohn (1904–1976), in: Jack Beatson/Reinhard Zimmermann (Hrsg.), Jurists Uprooted: German-Speaking Emigré Lawyers in Twentieth Century Britain, Oxford: Oxford University Press, 2004, 325–344; Siehe auch Henry Cohns Erinnerungen an seinen Vater: Henry J. Cohn, Ernst J. Cohn. Biography and Familiy Memoir, London: Privatpublikation 2019..
[6] Henry J. Cohn (Fn. 4), 36.
[7] Carl Bilfinger, Zum zehnten Jahrestag der Machtübernahme, ZAkDR 10 (1943), 17–18.
[8] Glahé/Mehring/Rieß (Fn. 1), 345–349.
[9] Felix Lange, Überraschende „Entnazifizierung“. Bilfingers Wiederberufung nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Glahé/Mehring/Rieß (Fn. 1), 405–424.
[10] Glahé/Mehring/Rieß (Fn. 1), 5.
[11] Hans Barion/Ernst Forsthoff (Hrsg.), Festschrift Für Carl Schmitt Zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern, Berlin: Duncker & Humblot 1959.

Katharina Isabel Schmidt ist Leiterin einer Nachwuchsforschungsgruppe am MPI für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg. Ihre Forschung vollzieht sich an der Schnittstelle zwischen Rechts-, Kultur- und Wissenschaftsgeschichte.